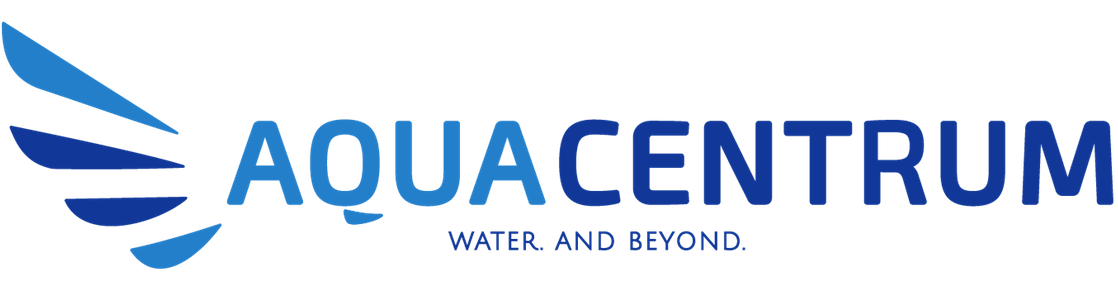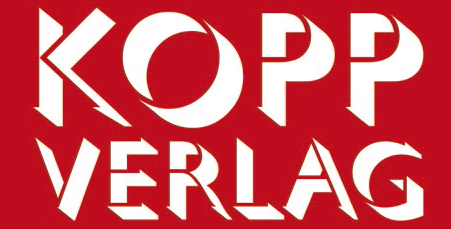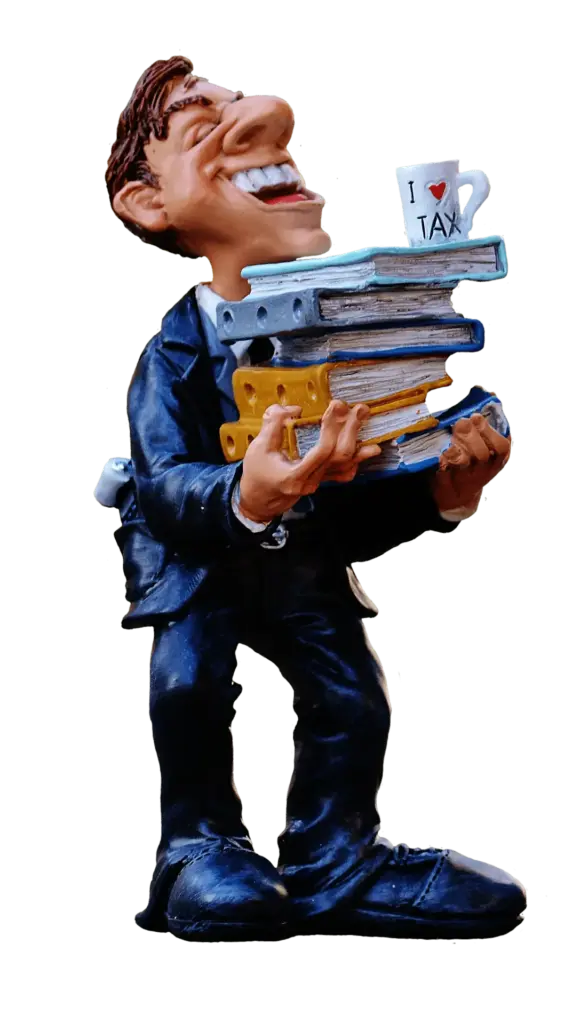Turbo Abschreibung auf E-Auto´s seit 1. Juli 2025
Die Turbo-Abschreibung für E-Autos in Deutschland: Chance für Steuerersparnisse und/oder verstecktes Risiko?
Die deutsche Bundesregierung hat mit der Einführung der sogenannten „Turbo-Abschreibung“ für rein elektrische Fahrzeuge ein deutliches Signal an Unternehmen gesendet: E-Mobilität soll attraktiv werden. Seit dem 1. Juli 2025 bietet der deutsche Staat mit der sogenannten Turbo-Abschreibung – offiziell Sonder-Abschreibung für Elektrofahrzeuge – einen Anreiz für Unternehmen, in emissionsfreie Mobilität zu investieren. Diese Regelung ermöglicht es, rein batterieelektrisch betriebene Fahrzeuge, die dem Anlagevermögen zugeordnet werden, besonders schnell steuerlich abzuschreiben. Sie gilt für Anschaffungen/Zulassungen bis zum 31. Dezember 2027 und soll die gewerbliche E-Mobilität fördern, nachdem Förderungen wie der Umweltbonus ausgelaufen sind. Im Folgenden beleuchten wir die Funktionsweise, die Vorteile und die Nachteile, insbesondere das Risiko des hohen Wertverlusts.
So funktioniert die Turbo-Abschreibung
Unternehmen können bei der Anschaffung eines E-Autos 75 Prozent der Anschaffungskosten bereits im ersten Jahr abschreiben. Es kommt hierbei nicht auf den Monat der Anschaffung an, was bedeutet, dass selbst bei einer Anschaffung im Dezember eines Jahres noch die volle Jahresabschreibung geltend gemacht werden kann. Die verbleibenden 25 Prozent werden degressiv verteilt: 10 Prozent im zweiten Jahr, je fünf Prozent in den Jahren drei und vier, drei Prozent im fünften und zwei Prozent im sechsten Jahr. Voraussetzung ist, dass das Fahrzeug wirtschaftlich dem Unternehmen gehört – also Kauf, Finanzierung oder Mietkauf – Leasing ist hierbei ausgeschlossen, hier mangelt es am Anschaffungsvorgang und der Zuordnung zum Unternehmen. Die Regelung gilt ausschließlich für reine Elektrofahrzeuge, nicht für Hybride oder Plug-in-Hybride. Dadurch entsteht eine schnelle steuerliche Entlastung:
Das Rechenexempel der Steuerersparnis:
Angenommen, ein Unternehmen kauft ein E-Auto für 60.000 € netto.
- Steuervorteil (Turbo-Abschreibung): Durch die 75 % Abschreibung im ersten Jahr (45.000 €) wird die Steuerlast deutlich reduziert. Die Steuerersparnis (bei einem Steuersatz von 30 %) beträgt 13.500 € (45.000 € × 30 %).
Bei Einzelunternehmern und Personengesellschaften kann die steuerliche Ersparnis im Anschaffungsjahr noch höher ausfallen. - Restbuchwert: Nach sechs Jahren ist das Fahrzeug, wie bisher auch, vollständig abgeschrieben und hat einen Buchwert von 1,00 €.
- Tatsächlicher Marktwert: Wenn das Auto nach beispielsweise nur drei Jahren verkauft werden soll, kann der tatsächliche Marktwert aufgrund des Wertverlusts (z. B. 40 % Wertverlust) nur noch 36.000 € betragen.
Die Vorteile: Schnelle Liquidität und Förderung der E-Mobilität
Die Turbo-Abschreibung macht E-Firmenwagen besonders attraktiv. Der größte Vorteil ist die intertemporale Steuerersparnis: Statt der üblichen linearen Abschreibung über sechs Jahre (ca. 16,67 Prozent pro Jahr) wird der Großteil der Kosten sofort „verbraucht“, was den Cashflow entlastet. Bei einem Refinanzierungszinssatz von vier Prozent ergeben sich Zinsvorteile von über 1.100 Euro in den ersten drei Jahren. Unternehmen können diese Liquidität für Investitionen nutzen, Schulden tilgen und/oder Zinsen sparen. Zudem stabilisiert die Förderung die Neuwagenpreise, da weniger Rabatte nötig sind.
Die Nachteile: Der Bumerang-Effekt und das Risiko des hohen Wertverlusts
Trotz der Vorteile birgt die Turbo-Abschreibung Risiken, die Unternehmen beachten müssen. Zum einen führt die schnelle Abschreibung zu einem „Steuer-Bumerang-Effekt“: Der Buchwert des Fahrzeugs sinkt schneller als der Marktwert, sodass bei einem späteren Verkauf nach beispielsweise drei Jahren der steuerpflichtige Buchgewinn doppelt so hoch sein kann wie bei einer linearen Abschreibung. Dies führt zu höheren Ertragsteuern (Einkommensteuer, Gewerbesteuer, ggfls. Körperschaftsteuer) als bei linearer, gleichmäßiger Abschreibung. Der hier dargestellte Effekt gleicht sich über die Zeit aus, je länger das Unternehmen das Fahrzeug im Unternehmen belässt.
Die Liquiditätsfalle des Verkaufs
- Buchgewinn: Da der Buchwert des Fahrzeugs nach der Turbo-Abschreibung im Verhältnis zum Marktwert sehr niedrig ist, entsteht beim Verkauf ein hoher Buchgewinn. Dieser Buchgewinn muss dann im Jahr des Verkaufs voll versteuert werden.
- Verlorenes Kapital: Das Unternehmen hat zwar über die Jahre Steuern gespart, aber das für den Kauf eingesetzte Kapital ist, abzüglich des Verkaufserlöses, dauerhaft gebunden und durch den Wertverlust geschmälert. Ist der Wertverlust höher als die Summe der Steuerersparnis, war der vermeintliche Steuervorteil tatsächlich ein Liquiditätsverlust.
Ein zentrales Risiko ist nämlich der potenzielle hohe Wertverlust von Elektrofahrzeugen, der durch die Turbo-Abschreibung verschärft wird. E-Autos verlieren in den ersten drei Jahren oft 40 bis 50 Prozent oder mehr ihres Werts. Gründe sind die schnelle Weiterentwicklung der Batterietechnik, die Alterung der Akkus, das nicht vorhandene Vertrauen in eine lange Lebensdauer der Elektrotechnik im Auto und ein zunehmend gesättigter Gebrauchtwagenmarkt durch steigende E-Auto-Zulassungen. Die Turbo-Abschreibung könnte dieses Problem verstärken, da mehr Unternehmen ab 2025 in E-Autos investieren könnten und diese in 3 bis 5 Jahren verkaufen, was die Restwerte weiter drücken könnte. Zudem birgt die Förderung Nachhaltigkeitsrisiken: Veraltete Modelle könnten die Kreislaufwirtschaft belasten, wenn Batterien nicht optimal recycelt werden. Unternehmen sollten daher Modelle mit hoher Restwertstabilität wählen oder längere Nutzungszeiten planen, um Verluste zu minimieren.
Fazit: Ein Turbo mit Risiken
Die Turbo-Abschreibung ist ein starker Anreiz für die E-Mobilität und bietet Unternehmen mit guter Planung klare Vorteile. Doch der Steuer-Bumerang-Effekt und vor allem das Risiko für einen Wertverlust bei kurzer Behaltedauer erfordern Vorsicht. Unternehmen sollten E-Autos langfristig nutzen oder auf Modelle mit stabileren Restwerten setzen. In der Vergangenheit haben Unternehmen gerne auf Leasingfinanzierungen zurückgegriffen, um das Risiko des Werterhaltes bzw. des Wertverlustes auf die Leasinggesellschaft bzw. den Hersteller abzuwälzen. Dieses Risiko verschiebt sich nun in die Unternehmen, wenn anstelle der Leasingfinanzierung ein Barkauf bzw. eine Darlehens- oder Mietkauffinanzierung zum Tragen kommt. Eine Beratung durch einen Steuerberater oder Unternehmensberater ist ratsam, um den individuellen Nutzen individuell zu bewerten.